0.1. Sprachgeschichte mit 'Dokumenten' - und nicht nur mit 'Monumenten'
Von Peter Koch stammt der Vorschlag, in der Sprachgeschichte zwischen ‘Dokumenten’ und ‘Monumenten’, d.h. “Texten mit einer großen kulturellen oder politischen Tragweite” (Koch 1993, 49) zu unterscheiden. Diese Opposition ist zwar ein wenig schwierig, da die ‘Tragweite’ oft erst im Rückblick konstatiert werden kann und keineswegs immer in der Intention der Verfasser (die im Übrigen häufig nicht mit den wirklichen Schreibern identisch sind) angelegt war. Aber sie ist insofern richtig und wirklich nützlich, weil sie darauf aufmerksam machen wollte, dass eben diese Monumente mit wirklicher oder im Lichte bestimmter Vorannahmen konstruierter ‘großer Tragweite’ auf Kosten der Gesamtheit aller überlieferten Dokumente in unangemessener Weise überschätzt wurden. Im Hinblick auf die Entwicklung der Sprache ist es jedoch von fundamentaler Bedeutung gerade die Masse der Texte in den Blick zu bekommen, um idiosynkratische Varianten als solche erkennen zu können.
“Der ungewöhnlich reiche Quellenbestand der italienischen Archive und Bibliotheken wird jedoch in der Forschung in der Regel nur als bekannt vorausgesetzt, allenfalls dankbar vermerkt oder als willkommener Zusatzbeleg für die frühe Reife der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse Italiens gewertet.” (Behrmann 1995, 1)
Eine breit angelegte Umsetzung dieser Einsicht ist also einstweilen leider noch nicht möglich, denn eine entsprechende Datenbasis ist (noch) nicht verfügbar. Digitalisierbare Editionen gibt es nur ganz punktuell, und eine direkte Digitalisierung von Originalmanuskripten überschreitet die aktuellen technischen Möglichkeiten der optical caracter recognition-Programme (OCR). Den Ausgangspunkt sollten die Texte der so genannten ‘pragmatischen Schriftlichkeit’ bilden; dieser Begriff ist von so grundlegender Bedeutung, dass er eine etwas ausführlichere Diskussion verdient.
“Als pragmatisch verstehen wir dabei alle Formen des Gebrauchs von Schrift und Texten, die unmittelbar zweckhaftem Handeln dienen oder die menschliches Tun durch die Bereitstellung von Wissen anleiten wollen. Pragmatische Schriftlichkeit in diesem Sinne war dem Mittelalter nie ganz fremd; denn der Gebrauch der Schriftkenntnis im Dienste praktischer Lebensbewältigung gehörte zu den Elementen der Schriftkultur, wie das Mittelalter sie von der griechisch-römischen Welt übernahm. Und dennoch hat es im frühen Mittelalter für den Schriftgebrauch unübersehbare Schranken gegeben. Gerade unter dem pragmatischen Aspekt tritt der Verlust antiker Schriftlichkeit im Übergang zum Mittelalter besonders deutlich in Erscheinung. Auch die karolingischen Bemühungen um die Ausbildung des Klerus und um den Aufbau einer Art Verwaltungsschriftlichkeit haben hieran letztlich nichts Entscheidendes geändert. Fehlten nur die materiellen und persönlichen Voraussetzungen für einen breiteren Einsatz der Schrift, vor allem in pragmatischen Zusammenhängen? Ist, mit anderen Worten, die Beschränkung des Schriftgebrauchs auf wenige durch Tradition vorgegebene, der Sphäre von Religion und Herrschaft zugeordnete Felder eher eine Frage der Bildung im technischen Sinn – oder ist sie eine Frage der Bedürfnisse, ist sie eine Frage des Schreiben-Könnens oder eines Schreiben-Wollens?” (Keller 1992, 1)
Diese rhetorische Frage deutet an, dass sich in spezifischen Konstellationen des Mittelalters die Einstellung zur Schriftlichkeit, das heißt die Einsicht in den alltagsweltlichen Nutzen geschriebener Aufzeichnungen grundsätzlich gewandelt hat.
0.1.1. Organsiationsliteratur
Besonders aufschlussreich ist die ‘Organisationsliteratur’. Dieser Ausdruck wurde in der Germanistik (von Meier/Möhn 2000, 1471) für Texte in und aus Institutionen der Hanse geprägt, nämlich für:
“Organisationseinheiten, die sozial abgegrenzt, für einen gesellschaftlichen Ausschnitt menschlichen Handelns strukturieren und regeln”. (Meier/Möhn 2000, 1471 zit. in Eufe 2006, 146)
Bei der Anwendung dieses Konzept ist es sinnvoll, zwischen ‘institutsinternen’, ‘institutsübergreifenden’, ‘institutsexternen’ Texten zu differenzieren. Gerade diese Organisationsliteratur ist in den ober- und mittelitalienischen Stadtgesellschaften (eigentlich: ‘Stadtstaatgesellschaften’), den comuni, von zentraler Bedeutung, die sich historisch in einer massenhafte Zunahme während des 13. Jahrhunderts niederschlägt.
Der Republik Venedig kommt in diesem Zusammenhang eine gewisse Sonderstellung zu, denn sie zeigt typisch kommunale Züge und steht gleichzeitig in einer gewissen Kontinuität mit der staatlich basierten Verwaltungs- und Schreibpraxis des byzantinischen Reichs (wie sich zum Beispiel in der Organisation des Schiffbaus zeigt). Vor allem ist jedoch die vorindustrielle kapitalistische Wirtschaftsform substantiell auf Schrift angewiesen:
“Hier hält der Bankier Feder und Heft bereit, um mit dem Wundermittel der Buchung (scritta) den Geschäftsverkehr der Kaufleute bargeldlos auf der Stelle, ohne Hinwarten auf die ehedem übliche Abrechnung auf den Messen, durch Giro-Überweisung abzuwickeln. Die banchi di scritta gestatten manchen Kunden sogar, ihr Konto zu überziehen; sie geben gelegentlich cedole, eine Art Wechsel, aus und spekulieren bereits mit den ihnen anvertrauten Einlagen, sofern sie nicht der Staat als Anleihe aufnimmt.” (Braudel 1990 a, 136)
Das Instrument der papierenen und beschriebenen Staatsanleihe wurde von der Signoria in einer staatlich kontrollierten Bank eingesetzt:
“BANCOZÌRO, s.m. Banco di Venezia o del giro, Banco mercantile che v’era e cessò col finire della Repubblica. Vi presiedeva una Magistratura dell’ordine Senatorio.” (Boerio 1856, 61)
Die Zunahme der pragmatischen Schriftlichkeit in den oberitalienischen Kommunen des Mittelalters ist also im Kern kein quantitatives, sondern ein qualitatives Phänomen, das sich ganz unmittelbar aus den veränderten Anforderungen der vom kapitalistischen Handel bestimmten Lebenswelt ergab:
“In Italien war demgegenüber nicht nur das Ausmaß der Schriftlichkeit von vornherein, d.h. auch im 10. und 11. Jahrhundert, wesentlich höher als in anderen Landschaften Europas. Im Zuge der kommunalen Entwicklung kam es während des 12. und 13. Jahrhunderts zu einer so raschen Ausweitung des Schriftgebrauchs, daß man hinsichtlich vieler Lebensvollzüge geradezu von einem Prozess der Verschriftlichung sprechen muß.” (Keller 1991, 343)
Wulf Oesterreich hat darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Begriff der Verschriftlichung aus einer "umfassenden gesellschaftlich-kulturhistorischen Perspektive" (Oesterreicher 1993, 280) zu sehen ist; er meint also nicht nur die visuelle Fixierung der primär akustischen wahrgenommenen Sprache, die Oesterreicher "Verschriftung"nennt, sondern die Implementierung des Schreibens und geschriebener Texte in die gesellschaftliche Praxis. Es ist also unumgänglich, den “Verschriftlichungsprozeß [...] als Ausdruck eines neuen Bewußtseins für die Möglichkeiten der Schrift [...]” (Behrmann 1995, 6) zu sehen.
“Hier wird der Prozeß der Verschriftlichung eingeleitet, welcher die europäische Kulturentwicklung bis ins 20. Jahrhundert prägt und sich im Spätmittelalter schon in einer wachsenden Alphabetisierung gesellschaftlicher Teilgruppen niederschlägt. Der Erfolg des Buchdrucks basiert bekanntlich auf diesen Voraussetzungen.” (Keller 1992, 2)
0.1.2. Verschriftlichung des Handels und Verrechtlichung der Gesellschaft
Der als Verschriftlichung identifizierte komplexe gesellschaftliche Wandel ist Ausdruck ganz unterschiedlicher Faktoren, die beim Aufstieg der obertitalienischen Stadtrepubliken zusammen wirken:
“[...] in den Städten, [...] sind die Ausbildungsstätten für jene mobile geistige Elite, die den Verschriftlichungsprozeß vorantreibt [...]”. (Keller 1992 a, 21)
Die Elite ist mobil und ihre Mobilität ist gleichzeitig Ausdruck eines starken demographischen und ökonomischen Wachstums der Städte; sie wird von den Interessen des Handels getragen und muss gleichzeitig den politischen Rahmenbedingungen, insbesondere der Besetzung der Ämter mit wechselnden Personen entsprechen. So wird gleichzeitig die Wiederentdeckung antiker Rechtstraditionen begünstigt, die massiv mit neuen Regelungen angereichert werden.
“Stadtbezogen ist in ihren Anfängen die Wiederaufnahme von Prinzipien des römischen Rechts, das gemäß seiner Herkunft aus der antiken Kultur ein höheres Maß an Schriftlichkeit voraussetzt; und im städtischen Leben mit seiner durch Zuwanderung rasch wachsenden Bevölkerung und einer sich steigernden sozialen Mobilität wird am schnellsten und deutlichsten sichtbar, daß die Verschriftlichung unmittelbarer Ausdruck einer Verrechtlichung der Sozialbeziehungen ist – einer Verrechtlichung in dem Sinne, daß formal festgelegte, ausdrücklich definierte Sachverhalte und Verpflichtungen allein rechtserheblich werden oder doch all das weit zurückdrängen, was vorher – in einer traditionalen Gesellschaft – sich oft unausgesprochen aus von der Sache unabhängigen Personalbeziehungen oder aus vollzogenen Handlungen an geschuldetem Verhalten und an bindenden Folgen ergab. Und mit dem städtischen Leben untrennbar verknüpft ist jene Gestalt, die vorberechnendes Handeln, 'Rechenhaftigkeit', zu verkörpern und für ihr 'Geschäft' ein rationales, punktuell von Handlungen und Sachverhältnissen ausgehendes Recht zu fordern scheint: der Kaufmann als die aufsteigende Sozialfigur des hohen und späten Mittelalters – neben und noch vor dem Intellektuellen, der sich im Studium die Voraussetzungen für eine Karriere im Herrschafts- und Verwaltungsdienst holt, die auf der Kenntnis neuer, an entwickelte Schriftlichkeit gebundener geistiger Techniken zur Organisation des Lebens beruhen." (Keller 1992, 22)
Schon der zeitgenösssische Rechtsgelehrte Johannes Bononiensis hat in seiner Summa de arte notarie festgehalten, dass der Anspruch auf öffentlich institutionalisierte Schriftlichkeit spezifisch 'italienisch' war:
“Ytalici tamquam cauti quasi de omni eo quod ad invicem contrahunt habere volunt publicum instrumentum, quod quasi contrarium est in Anglicis, videlicet quod nisi necessarium esset non nisi rarissime petitur instrumentum.” (zit. in Keller 1992, 23, Anm. 9)
'Die Ytalici ['Italiener'] sind so vorsichtig, dass sie für alles, das sie vereinbaren ein öffentliches Dokument wollen, was quasi im Gegensatz zu den Engländern steht, es ist [dort] offensichtlich so, dass, wenn es nicht notwendig ist, nur höchst selten ein Dokument verlangt wird' (Übers. ThK.)
Der Ausdruck instrumentum publicum (vgl. Treccani s.v. strumento 6) steht übrigens die Entstehung einer bis heute sehr wichtigen öffentlichen Institution voraus, von der die Glaubwürdigkeit des Schriftstücks unabhängig vom garantiert wird. Dieses spezifisch städtische Amt wurde unter der schon älteren Bezeichnung notaio 'Notar' 'Schreiber' in den oberitalienischen Kommunen eingerichtet, die im ehemals byzantinischen Herrschaftbereich lagen.
Alles in allem manifestiert sich ein stadtstaatlicher “[...] Wille[...] zur Entpersonalisierung von Regierung und Amtsverwaltung" (Keller 1992 a 24) und - möchte man hinzufügen - zur Standardisierung von merkantilen Transaktionen. Die gennannten Faktoren fließen in einer neuen Diskurstradition ('Gattung') zusammen, den als statuti bezeichneten kommunalen Rechtskodifikationen (vgl. Treccani, s.v. statuto 2, 2a).
“Dabei darf der Statutencodex, in dem die Kommune ihr selbstgesetztes Recht fixiert, publiziert und aktualisiert, gewiß als besonders markantes Zeugnis der neuen kommunalen Schriftlichkeit gelten. Die Praxis der Stadtregierungen, für rechtliche, politische und administrative Zwecke Bücher anzulegen, geht indessen weit über die Statutencodices hinaus. Und neben der Arbeit in und mit Büchern kümmerten sich die kommunalen Notare um das täglich anfallende Schriftgut wie etwa Briefe, Ratsprotokolle, Gerichtsakten, Konsulspräzepte und diverse andere Urkunden und Aktenstücke.” (Behrmann 1995, 2)
Aus moderner Sicht ergab sich aus der Verrechtlichung in Gestalt geschriebener Gesetze und Verordnungen in vielen Bereichen eine extreme und sehr schwerfällige Überregulierung, wie Hagen Keller eindrücklich zusammenfasst:
“Vorschriften regeln den menschlichen Lebensalltag in den italienischen Kommunen des Duecento auf vielfältige Weise; das Ausmaß übersteigt alles, was sonst aus dem damaligen Europa bekannt ist. Einige Kostproben mögen dies illustrieren: Niemand darf ein fremdes Feld betreten, ohne die notariell beglaubigte Ermächtigung durch den Eigentümer mit sich zu führen; niemand darf mehr als eine festgesetzte Menge Getreide als Vorrat im Haus haben; jede Familie darf pro Woche höchstens soundsoviel Getreide oder Hülsenfrüchte auf dem Markt kaufen; jeder Brotlaib muß mit dem Namen des Bäckers gestempelt sein; bei der Beerdigung ist höchstens die und die Zahl von Trauergästen, Totenkerzen, Klageweibern zugelassen; für die Kleidung der Frauen wird die Höchstbreite der Hutbänder oder die Höchstzahl der Zierknöpfe am Obergewand festgelegt. Die Vorschriften selbst sind wiederum in ein ganzes System schriftlicher Fixierungen eingebunden: Das instrumentum publicum mit der Ermächtigung zum Betreten eines fremden Feldes ist über die Notarsimbreviaturen quasi amtlich registriert; die Rationierung auf dem Markt ist nur praktikabel bei einer lückenlosen Registrierung der einschlägigen Marktgeschäfte und dem Abgleich mit den Verzeichnissen zur Erfassung der Einwohnerschaft; ein Verstoß gegen die Luxusgesetze soll bei der Entdeckung sofort protokolliert und dem für die Ahndung verantwortlichen Amtsträger schriftlich angezeigt werden; und auch damit erfassen wir nur einen Ausschnitt aus den auf die Vorschrift rückbezogenen schriftlichen Prozeduren.” (Keller 1999, 29)
Kritische Bewertungen dieser Verhältnisse finden bereits bei zeitgenössischen Autoren, wie z,B. bei Buoncompagno da Signa:
“Leges municipales atque plebiscita sicut umbra lunatica evanescunt, quoniam ad similitudinem lune crescunt iugiter et decrescunt, secundum arbitrium conditorum.” (Busch 1991, 373)
'Die städtischen und von den Bürgern erlassenen Gesetze erscheinen wie der Mondschattem, da sie ähnlich wie der Mond beständig zu- und abnehmen, nach der Willkür ihrer Begründer' (Übers. ThK)
In gewisser Hinsicht führt das allgemeine Bedürfnis nach minutiösen Regelungen, das auch das ländliche Leben erfasst (vgl. Keller 1991, 343, 347), also in einen Widerspruch, da permanent Modifikationen angebracht werden (müssen). Moderne Gesetzeskodizes sind ja deshalb im Gegensatz zu diesen Sammlungen grundsätzlich auf Dauerhaftigkeit hin angelegt (und entsprechend abstrakt formuliert):
"Das Statutenbuch einer oberitalienischen Kommune im 13. Jahrhundert bot also den rechtsgelehrten Zeitgenossen, wie auch dem heutigen Betrachter das irritierende Bild eines ‘Gesetzbuches’, dem gerade die Dauer, Statik und Verläßlichkeit eines solchen fehlte. Ganz im Gegenteil vermittelte dieser Codex jenen Eindruck, den Buoncompagnus [...] wiedergab: nämlich in ständiger Ausweitung und Beschränkung begriffen zu sein. Auf das hierzu verwandte Instrumentarium der Schrift bezogen, schlug sich diese Entwicklung rein kodikologisch in Interlinear- und Marginaleinträgen, Rasuren und Kanzellaturen nieder, die das äußere Bild des kommunalen Gesetzbuches prägten. (Busch 1991, 387)
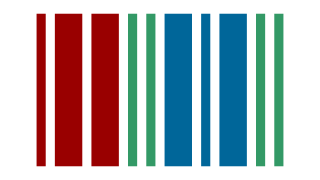
Eine Antwort